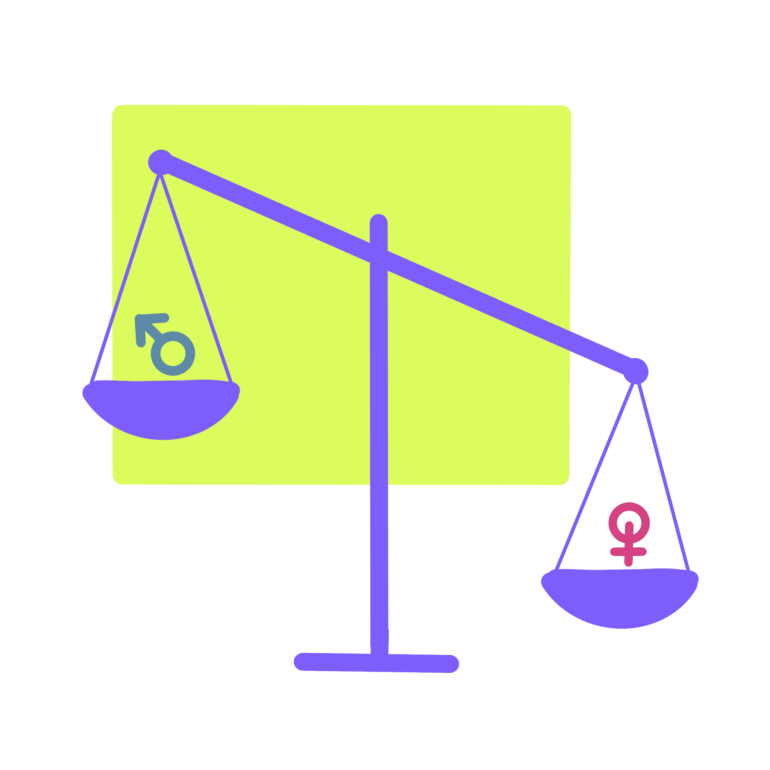Der Fehlschluss der «Scheinkausalität», oder eben «Cum hoc ergo propter hoc» stellt eines der Grundprobleme der Wissenschaft dar. Seine Missachtung kann zu absurden Fehlinterpretationen führen – wie jüngst in der Diskussion um die Lohndiskriminierung offenbar wurde. Eine kleine Recherche dazu.
Jennifer Widmer, Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften und Luca Keiser, Lucerne Master in Computational Social Sciences
Illustration: Selma Badic, Soziologie
«Cum hoc ergo propter hoc»; was sich anhört wie «der heisseste Scheiss» direkt aus Hogwarts hat mit Hexerei wenig zu tun. Es ist Latein und bezeichnet den Fehlschluss der Scheinkausalität: also den Fehler von einer Korrelation direkt auf eine Kausalität schliessen zu wollen. Am Ende des Lateins? Besser nicht, denn hinter diesem Ausdruck verbirgt sich eines der Urbedürfnisse der Menschheit: Phänomene auf eine Ursache zurückführen und damit kausale Zusammenhänge bestimmen zu können.
Was passiert, wenn cum hoc ergo propter hoc Latein bleibt, konnten wir jüngst an der Diskussion über die Lohndiskriminierung beobachten.
Die Scheinkausalität erklärt
Früher glaubte man etwa, dass die Launen der Götter die Ursache für Unwetter seien. Oder man war davon überzeugt, dass Babys von den Störchen gebracht werden. Beides haben einige von uns wohl selbst noch erzählt bekommen. Auf den ersten Blick ist letztere Erzählung gar nicht so abwegig. Schliesslich lässt sich tatsächlich beobachten, dass die Geburtenrate in Gebieten mit vielen Störchen wesentlich höher ist. Schlussfolgerung: Die Störche (Ursache) bringen die Kinder (Wirkung).
Bei genauerer Betrachtung kommen schnell Zweifel am vermuteten Kausalzusammenhang auf. Beide Variablen korrelieren zwar positiv miteinander. Diese anfänglich beobachtete Korrelation kommt aber lediglich dadurch zustande, dass die Lebensbedingungen für Störche in den ländlichen Regionen besser sind und dort tendenziell auch mehr Kinder pro Paar geboren werden. Kontrolliert man jedoch den Urbanisierungsgrad als Drittvariable, verschwindet der anfängliche Zusammenhang zwischen Anzahl Störchen und Geburtenrate. Dementsprechend handelt es sich hier um eine Scheinkausalität. Es sind also nicht die Störche, welche die Kinder bringen.
Der Fehlschluss besteht darin, von einer anfänglichen Korrelation direkt auf eine Kausalität schliessen zu wollen – cum hoc ergo propter hoc also.
Messbarkeit eines Urbedürfnisses
Das Storchenbeispiel leuchtet ein. Das ist auch der Grund, warum es in der Methodenausbildung häufig als Erklärung für den Unterschied von Korrelation und Kausalität eingesetzt wird. Der Haken an der Geschichte: Es ist ein verständliches, aber fiktives und stark vereinfachtes Exempel – entwickelt für die Lehrbücher.
Damit man von einem wirklichen Kausalzusammenhang sprechen kann, müssen weitere Anforderungen erfüllt sein, welche sich in der Empirie nicht so einfach belegen lassen. Dabei ist besonders die Identifikation von wesentlichen Störgrössen eine grosse Herausforderung der (Sozial)Wissenschaft. Wie kann man sich beispielsweise sicher sein, alle relevanten Variablen berücksichtigt zu haben? Anders gefragt: Lässt sich dieser beobachtete Output wirklich auf diesen einen Input zurückführen?
Die Beantwortung dieser Fragen ist schwierig. Obwohl Kausalität einem der Urbedürfnisse der Menschheit entspricht, existiert dafür keine statistische Masszahl. Solch eine Masszahl kann aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auch gar nicht existieren. Wir verfügen zwar über wissenschaftliche Vorgehensweisen, etwa dem Experiment (orientiert an den Naturwissenschaften) oder dem Quasi-Experiment, um Kausalbeziehungen plausibilisieren zu können. Beweisen im Sinne einer numerischen Grösse können wir diese jedoch nie. Wenn es keine Naturgesetze gibt, dann kann es sozusagen auch keinen Test für Kausalität geben.
Lohndiskriminierung in der Schweiz?
Seit 1994 erhebt das Bundesamt für Statistik (BfS) alle zwei Jahre mittels einer schriftlichen Befragung die Lohnstrukturen in der Schweiz. Der zentrale Beitrag der Untersuchung besteht darin, die gesamte Lohndifferenz in einen erklärten und einen unerklärten Anteil zu zerlegen. Damit soll gezeigt werden, welcher Anteil des Lohnunterschieds durch beobachtbare Merkmale wie Alter, Ausbildungsniveau, Branche, Beruf usw. zustande kommt und welcher Anteil unerklärt bleibt.
Eine Erhebung, in welcher geschlechtsspezifische Lohnunterschiede aufgezeigt werden und kontroverse Diskussionen vorprogrammiert sind.
Frauen, so die Ergebnisse der BfS-Untersuchung, verdienen im Schnitt rund 17,4% weniger als Männer. Diese Differenz lässt sich teilweise durch das statistische Modell (also durch die oben erwähnten Merkmale wie Alter, Ausbildungsniveau etc.) erklären. Übrig bleibt jedoch eine unerklärte Lohndifferenz von 7,7 %. Das bedeutet, dass «Frauen bei vergleichbaren, beobachtbaren Merkmalen im Schnitt 7,7% weniger verdienen als Männer».
Aufgrund dieser Ergebnisse sprachen öffentliche Personen von einer Lohndiskriminierung. Institutionen wie das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau oder das BFS selbst verwendeten in diesem Zusammenhang stets den Ausdruck potenzielle Lohndiskriminierung.
Andere Stimmen wiederum bezweifeln, dass man von einer Lohndiskriminierung sprechen kann und bemängelten die Erhebungsmethode des Bundesamts für Statistik. Zum Beispiel seien wichtige, aber schwierig zu erhebende Grössen wie die Berufs- und Führungserfahrung, Weiterbildungen, Sprachkenntnisse und der Beschäftigungsgrad über die Berufskarriere als Variablen bei der Lohnstrukturerhebung nicht berücksichtigt worden. Würde man diese Variablen in der Untersuchung mit einbeziehen, würde der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen sinken. Weiter vermuten sie eine Verzerrung des kausalen Effekts, da nicht-beobachtbare Grössen wie die Risiko- und Zeitpräferenz unbeachtet blieben.
Aufgrund der Uneinigkeit wurde vom Bund eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben, welche ebenfalls auf die oben genannten methodischen Mängel der BfS-Studie hinwies. Die Vermutung, dass der unerklärte Anteil des Lohnunterschieds sinken würde, wenn weitererelevante Variablen in das statistische Modell aufgenommen werden, mag zutreffen. Entscheidend hierbei ist jedoch, dass der unerklärte Anteil bei keiner der durchgeführten Untersuchungen mit Sicherheit komplett verschwinden würde.
Werden Frauen nun beim Lohn diskriminiert?
Im Falle der Lohnstrukturerhebungsstudie liegt – ähnlich wie beim Storchenbeispiel – anfangs eine Korrelation vor. Im Unterschied zum Storchenbeispiel bleibt jedoch unklar, ob alle relevanten Variablen bei der Bestimmung des kausalen Zusammenhangs berücksichtigt worden sind. Welches sind nun gültige Aussagen, die wir anhand der Lohnstrukturerhebung des Bundes machen können? Hat das Geschlecht nun einen kausalen Einfluss auf den Lohn?
Die Autor*innen der BfS-Studie machen deutlich, dass die unerklärte Lohndifferenz quantitativ nicht mit Lohndiskriminierung gleichgesetzt werden kann. Sie weisen aber umgehend darauf hin, dass die Ergebnisse qualitative Hinweise für eine potenzielle Lohndiskriminierung beinhalten.
Ob Frauen nun bezüglich des Lohns diskriminiert werden oder nicht, lässt sich anhand dieser Studie nicht beantworten. Das liegt daran, dass der effektive Einfluss des Geschlechts auf den Lohn darin gar nicht erfasst wird. Bei der BfS-Studie handelt es sich um eine deskriptive Korrelationsstudie. Es ging nie darum Kausalität zu identifizieren, geschweige denn zu beweisen. Zu behaupten, dass eine Lohndiskriminierung vorliege, ist genauso falsch wie zu behaupten, dass keine vorliege – cum hoc ergo propter hoc also.
Die Lohnstrukturerhebung des Bundes liefert uns Korrelationen und keine Kausalitäten. Das menschliche Urbedürfnis – Wirkungen auf Ursachen zurückzuführen – bleibt damit unbefriedigt. Aus diesem Grund sind weitere Untersuchungen zum unerklärten Anteil der Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern eingeleitet worden.
Erklärt man jedoch weitere Untersuchungen aufgrund dieser Studie als schwachsinnig, ist das aus einer wissenschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Perspektive – aufgrund der qualitativen Hinweise und den noch offen gebliebenen Fragen – nicht nachvollziehbar.
Ganz grundsätzlich gilt hier: further research is needed.
Cum hoc ergo propter hoc ist Latein und steht für den Fehlschluss der Scheinkausalität. Gerade in Debatten, die weitreichende gesellschaftliche Implikationen mit sich bringen, ist es wichtig, die Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität zu kennen. Personen, welche anhand der Lohnstrukturerhebung des Bundes die Lohndiskriminierung als nicht existent abtun, äussern in erster Linie eine persönliche sowie politische Meinung. Diese ist nicht wissenschaftlich fundiert, sondern reiner Dogmatismus. Nur weil es anhand eines statistischen Modells nicht möglich ist, eine Kausalbeziehung eindeutig identifizieren zu können, heisst das noch lange nicht, dass es diese nicht gibt. In Zeiten von Fake News ist es hilfreich selbst zu erkennen, wann Aussagen durch wissenschaftliche Erkenntnisse belegt werden können und wann es sich einfach um eine persönlich gefärbte Meinung handelt.
Cum hoc propter ergo hoc: Eine Herausforderung in der Wissenschaft, aber keine Hexerei.